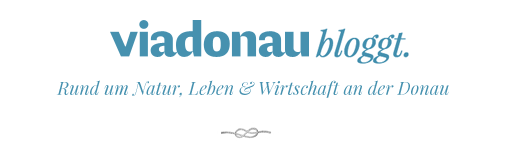Was wächst denn da? Vegetationsmonitoring am Hochwasserschutzdamm
Im Rahmen des Projekts „Blühende Dämme an March und Thaya“, das vom Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft gefördert wird, wurde 2024 und 2025 das Mähgut abschnittweise von den Hochwasserschutzdämmen abtransportiert.